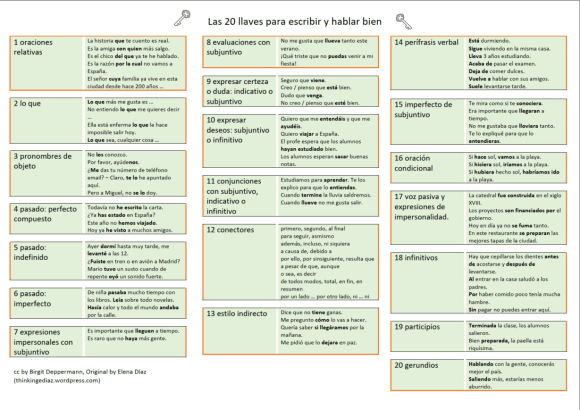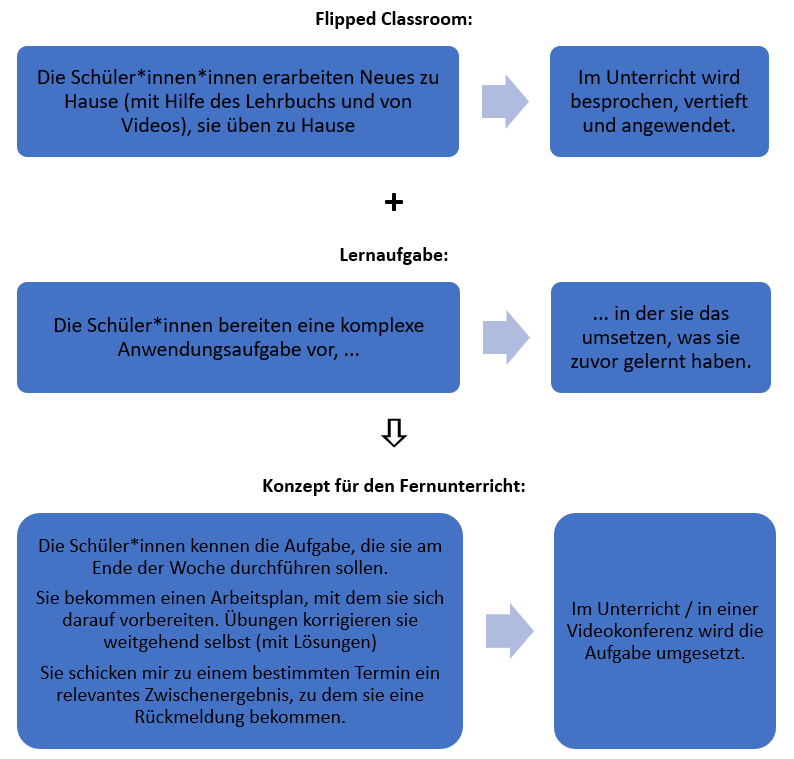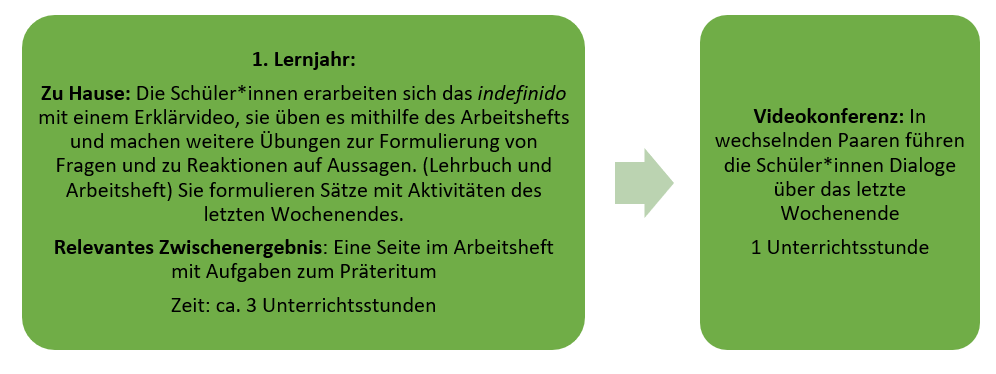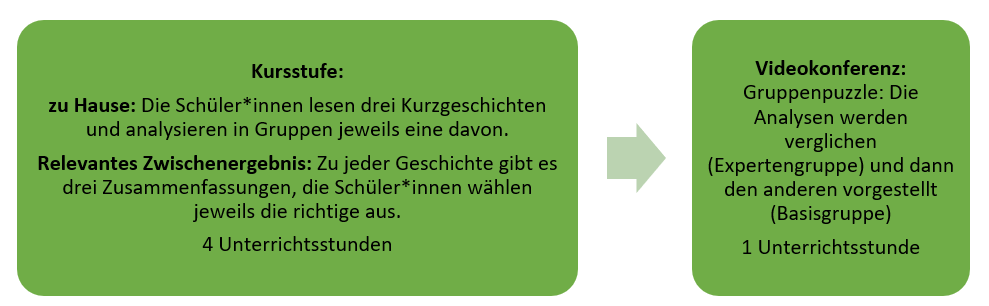In Madres paralelas, einer dramatischen Geschichte um die Freundschaft zweier ungleicher Mütter und die Selbstfindung einer jungen Frau, setzt sich Almodóvar auch mit der spanischen Geschichte und der memoria histórica auseinander. Sowohl in der Handlung als auch in der ansprechenden Darstellung des modernen Spaniens liegt großes Potenzial für den Spanischunterricht in der Oberstufe.
Handlung
Zwei werdende Mütter lernen sich im Krankenhaus kennen und freunden sich trotz denkbar großer Unterschiede in Alter, Lebenssituation und auch Einstellung zu ihrer Schwangerschaft und der bevorstehenden Geburt an. Janis ist Anfang 40, selbständige Fotografin, und entschlossen, ihr Kind, das Resultat einer Affäre, allein aufzuziehen. Ana ist noch Teenager, ungewollt schwanger und findet wenig Unterstützung bei ihren getrenntlebenden Eltern. Beide Babys müssen kurz untersucht werden, ehe sie von den Müttern mit nach Hause genommen werden. Was als unwichtiger Zwischenfall erscheint, erweist sich später als schicksalhaft: Als Janis und Ana sich einige Zeit später wieder begegnen, wird Janis nach und nach klar, dass die Babys im Krankenhaus vertauscht wurden. Die (melo)dramatische Handlung um die beiden Frauen (Das bei Ana lebende Kind ist inzwischen am plötzlichen Kindtod gestorben) ist in einen weiteren Handlungsstrang eingebettet, der im zweiten Teil des Films an Bedeutung gewinnt: Arturo, der Vater von Janis Kind, ist forensischer Anthropologe und arbeitet für eine Stiftung, die sich für die Aufarbeitung der Verbrechen des Franco-Regimes einsetzt. Janis und einige Bewohner ihres Heimatdorfs beantragen die Exhumierung eines Massengrabs, in dem die Leichen von republikanischen Opfern des Regimes liegen, darunter Janis Urgroßvater.
Historischer Hintergrund
Der historische Bezug der Handlung ist ein erster Ansatzpunkt für den Einsatz des Films im Spanischunterricht im Rahmen der Behandlung des franquismo und der memoria histórica. Janis‘ Einsatz für die Exhumierung ihres Urgroßvaters zeigt, wie schwer es immer noch ist, Gerechtigkeit für die Verbrechen der Vergangenheit durchzusetzen. Obwohl die Verbrechen des Franco-Regimes in der Ley de la Memoria Histórica anerkannt werden, müssen die Hinterbliebenen der Opfer nach wie vor darum kämpfen, dass ihre Angehörigen gefunden und die Massengräber aus jenen Tagen exhumiert werden. Die Regierung von Mariano Rajoy reduzierte erst die Finanzierung und verweigerte sie schließlich ganz, so dass Exhumierungen kaum noch möglich waren. Auch fast 45 Jahre nach dem Ende der Diktatur ist ihre Aufarbeitung noch nicht abgeschlossen, stößt auf den Widerstand sehr konservativer Kreise und wird auch von anderen Spaniern als Aufreißen alter Wunden kritisch gesehen. “¡A ver si te vas enterando de en qué país vives!” ruft Janis der jungen Ana zu, die kein Verständnis für ihr Bemühen um die Exhumierung ihres Urgroßvaters hat: „Los muertos es mejor dejarlos donde están.“ Madres paralelas zeigt also den sehr aktuellen Streit um den Umgang mit der Vergangenheit.
Väter, Mütter und die Wahrheit
Die beiden Handlungsstränge stehen nicht unverbunden nebeneinander. In Madres paralelas durchdringt die Geschichte das moderne Leben und prägt das Leben der Protagonist*innen. Deutlich wird dies beispielsweise in der Darstellung der Väter, die dieser Rolle fast durchweg nicht gerecht werden: Janis hat ihren eigenen Vater nie kennengelernt, er hat ihre Mutter vor ihrer Geburt verlassen. Ana scheint ihrem leiblichen Vater, der mit seiner zweiten Frau zusammenlebt, lästig zu sein. Nur widerstrebend nimmt er sie bei sich auf. Alberto, der Vater von Janis Tochter, ist noch verheiratet und zunächst nicht bereit, sich von seiner Frau zu trennen. Als er Janis besucht und sie ihm ihre Tochter vorstellt, distanziert er sich, weil er meint, sich in ihr nicht wiederzuerkennen. Ana selbst wurde schwanger, als sie bei einem Jungen, in den sie verliebt war, von ihm und seinen Freunden zum Sex genötigt wurde; lange Zeit weiß sie nicht, wer der leibliche Vater ihres Kindes ist. Es scheint, als sei das Verhältnis der Väter zu ihren Kindern und Partnerinnen von Vernachlässigung und Gewalt geprägt. Als einzige positive Vaterfigur erscheint dagegen Janis Urgroßvater: Die Großmutter erzählt, dass er mit seiner jüngsten Tochter spielte, als er von Soldaten abgeführt und hingerichtet wurde. Die Rassel des Kindes, die er damals in der Hand hielt, wird bei der späteren Exhumierung bei ihm gefunden. Auch Alberto erweist sich als besserer Vater, als es zunächst den Anschein hat: Das von ihm zurückgewiesene Kind ist tatsächlich nicht seines. Dafür befindet er sich am Schluß des Films in einer Beziehung mit Janis, die wieder schwanger ist. In Verbindung mit dem zweiten Handlungsstrang, scheint diese Unfähigkeit der Väter durch die spanische Geschichte und ihren Umgang damit bedingt zu sein: Der „gute“ Vater wird durch ein Erschießungskommando seinen Kindern entrissen, und erst, als dieses Verbrechen im wahrsten Sinn des Wortes aufgedeckt ist, kann der Mann, der es aufgedeckt hat, ebenfalls zu einem echten Familienvater werden. Dazwischen liegen Gewalt, Abwesenheit und Vernachlässigung.
Wie auch in anderen Filmen Almodóvars nehmen die Frauen eine aktive Rolle ein und suchen nach Auswegen, sowohl für sich selbst als auch für ihre Familien. Sowohl Janis als auch Ana sind liebevolle Mütter, ohne in eine traditionelle Rolle zu verfallen: Janis setzt sowohl ihre berufliche Tätigkeit wie auch ihr politisches Engagement fort, während Ana sich mit ihrer familiären Situation auseinandersetzt und nach Unabhängigkeit strebt. Für beide ist dies mit Schwierigkeiten verbunden: Janis‘ Tochter wird während ihrer Arbeitszeit von einem Au Pair-Mädchen versorgt, das sich in ihren Augen nicht genug um die Kleine kümmert. Ana muss zunächst bei den ungeliebten Eltern wohnen, weil sie keine Möglichkeit sieht, sich und das Kind zu versorgen. Mutter zu sein ist auch im modernen Spanien nicht einfach, aber immerhin ist die Verbindung von Mutterschaft und Selbständigkeit eine Möglichkeit, während eine Generation zuvor Anas eigene Mutter daran noch gescheitert ist: Scheint sie zu Beginn die Bedürfnisse ihrer Tochter ihrem eigenen Egoismus zu opfern, zeigt sich, das dieses Vorgehen biografisch bedingt ist, denn da sie ihren Wunsch, Schauspielerin zu werden, ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter nicht unterordnen wollte, erklärte ein Gericht bei der Trennung von ihrem Mann sie für unfähig, die gemeinsame Tochter aufzuziehen und sprach sie ihrem Mann zu..
Was alle Frauen eint, ist die Suche nach sich selbst innerhalb unsicherer Umstände. Diese sind ökonomisch und sozial bedingt, finden sich aber auch in den familiären Strukuren wieder, die auch hier die Auswirkungen der Diktatur auf die spanische Gesellschaft zu spiegeln scheinen: Janis und Ana verlassen das Krankenhaus jeweils mit dem falschen Kind, das eigene wurde ihnen dort genommen. Auch wenn es sich um ein Versehen zu handeln scheint, kann man nicht umhin an die niños robados zu denken, die im franquismo gerade alleinstehenden Müttern nach der Geburt weggenommen und an regimetreue Familie weitergegeben wurden. Die Mütter erfuhren, wenn überhaupt, erst viel später von dem tatsächlichen Schicksal ihres Kindes, auch dann ohne die Möglichkeit, es wiederzusehen, ähnlich wie Janis, die sich, als ihr die Verwechslung bewusst wird, auch mit dem Tod ihres leiblichen Kindes auseinandersetzen muss. Solange sie ihr Wissen für sich behält, ist das Verhältnis zu Ana konflikthaft: diese sieht in ihr ein Vorbild, später eine Geliebte, beides Rollen, die Janis nicht wirklich übernehmen möchte. Auch hier führt erst die Wahrheit zu einer Auflösung: Ana nimmt ihr Kind und verlässt Janis‘ Wohnung; am Schluss scheinen sie aber wieder zu einer Freundschaft zurückgefunden zu haben und auch Janis‘ Kontakt zu dem Kind, das sie lange für ihre eigenes hielt, bleibt bestehen. Auch Anas Mutter kann sich, nachdem sie Ana und Janis ihre Geschichte erzählt hat, auf ihre Tochter einlassen, ohne ihre eigenen Wünsche zurückzustellen.
Madres paralelas im Spanischunterricht
Madres paralelas eignet sich aufgrund der Thematik aber auch der sprachlichen Anforderungen für den Unterricht in der Oberstufe.
Als Einstieg eignet sich die Frage nach der Perspektive der Schüler*innen zu den grundlegenden Themen: ¿Para tí, la historia es importante? ¿Sabes cómo quieres vivir en el futuro? ¿Será importante para ti tu trabajo, tener hijos, ser independiente …? Anworten können in einem Plakat oder einer digitalen Pinnwand gesammelt werden.
Die Schüler*innen sollten den Film ohne zu viel Lenkung von außen sehen. Als Grundlage zur weiteren Arbeit wäre es aber sinnvoll, dass sie ihre Eindrücke direkt im Anschluss festhalten und sich Stichpunkte zu den Hauptpersonen, den wichtigsten Ereignissen und den visuellen Eindrücken machen.
Spaniens Geschichte und der gesellschaftliche Umgang mit ihr bieten sich als ein Fokus der Arbeit mit dem Film an, ebenso der analytische Blick darauf, wie Almodóvar diese in dem Film darstellt. Der sozio-historische Aspekt kann auch unter dem Blickwinkel der Demokratiebildung betrachtet werden: Ein Vergleich der Positionen Anas und Janis‘, die Frage nach der Wirkung und den Handlungsmöglichkeiten politischen Engagements.
Da die Protagonistin Ana im Alter der Schüler*innen und auf der Suche nach sich selbst ist, lässt sich auch darüber gut an ihre Lebenswelt anknüpfen. So wirft der Film die Frage nach der Selbstverwirklichung auf: Wie möchte ich leben? Wo sehe ich mich in Zukunft? Welche Rolle spielen / wer sind Vorbilder für mich? Hier könnte Janis als Vorbild für Ana genauer in den Blick genommen werden: Sie lebt ihr finanzielle Unabhängigkeit vor, bringt ihr bei, traditionelle spanische Gerichte zu kochen und fordert sie auf, eine politische Position einzunehmen. Zugleich setzt Ana sich auch kritisch mit ihr auseinander. Könnten auch die Schüler*innen sie als Vorbild sehen? Schwierig kann hier sein, dass es in dem Film kein wirkliches männliches Vorbild gibt – eventuell könnte die Figur Alberto unter diesem Blickwinkel analysiert werden.
Eine wichtige Stellung nehmen in Almodóvars Film auch die Bilder der Orte ein: ein ansprechendes, modernes und lebendiges Madrid und Janis Heimatdorf, sowie Janis Wohnung und das Haus ihrer Großeltern.
Schließlich können der Regisseur Almodóvar und seine filmische Arbeit in den Bick genommen werden.
Falls der Film nicht im Zusammenhang mit einer Einheit zur spanischen Geschichte gesehen wird, ist es sinnvoll, einige Aspekte vorher aufzuarbeiten. Materialien und Vorschläge zur Vorgehensweise finden sich auf dem Arbeitsblatt „trasfondo“. Die Schüler*innen können im Anschluss an die Filmschau weitgehend selbständig arbeiten und auch eigene Schwerpunkte setzen. Vorschläge dazu stehen auf dem Arbeitsblatt „tareas afinales“. Die fertigen Analysen werden in einem Marktplatz vorgestellt und von den Mitschüler*innen kommentiert. Hierbei können sie wieder auf ihre Überlegungen zur Einstiegsfrage zurückgreifen.
Hier sind die Arbeitsblätter zur Vorbereitung sowie zur tarea final: